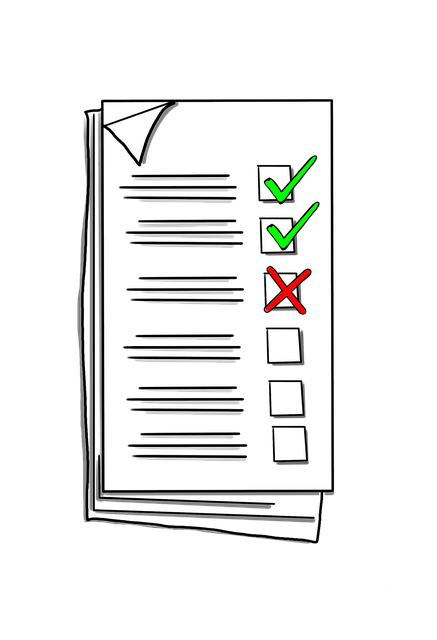Inhaltsverzeichnis
ToggleEinleitung
Ein Antrag auf Feststellung des Grades der Behinderung (GdB) ist für viele Menschen ein Schritt, den sie lange vor sich herschieben. Verständlich – schließlich warten Formulare, unverständliche Rechtsbegriffe und die Aussicht auf monatelanges Warten. Kurz: Bürokratie at its best.
Und doch lohnt es sich. Denn der GdB ist viel mehr als eine Zahl auf einem Bescheid. Er ist die rechtliche Anerkennung dessen, was Sie ohnehin schon wissen: Dass Ihre Erkrankung oder Behinderung Sie im Alltag einschränkt. Und er ist der Schlüssel zu Rechten und Nachteilsausgleichen – vom Steuerfreibetrag über Zusatzurlaub bis hin zum besonderen Kündigungsschutz.
Wer sich durch den Antragsdschungel kämpft, wird am Ende belohnt. Allerdings nur, wenn der Antrag sorgfältig vorbereitet ist. Denn: Was Sie nicht angeben, kann nicht berücksichtigt werden. Was Sie ungenau beschreiben, wird leicht abgetan. Und was das Amt nicht erfährt, existiert in der juristischen Realität nicht.
In diesem Beitrag finden Sie alles, was Sie brauchen: von den Grundlagen über konkrete Beispiele bis hin zur Schritt-für-Schritt-Anleitung. Sie erfahren, worauf es ankommt, welche Unterlagen Sie einreichen sollten, welche Fehler häufig passieren – und wie Sie mit einem Widerspruch reagieren, wenn der erste Bescheid nicht passt.
Und wenn Sie danach noch tiefer eintauchen wollen: Am Ende dieses Artikels finden Sie den Hinweis auf meinen Onlinekurs zum Grad der Behinderung, in dem ich Sie Schritt für Schritt begleite – mit Checklisten, Mustertexten und vielen Beispielen aus meiner Praxis als Fachanwältin für Sozialrecht.
Die Grundlagen rund um den Grad der Behinderung
Was ist der Grad der Behinderung?
Der Grad der Behinderung (GdB) ist eine Kennzahl zwischen 20 und 100, die in Zehnerschritten festgelegt wird. Er beschreibt nicht Ihre Diagnose, sondern die Auswirkungen auf Ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.
Ab einem GdB 50 gelten Sie offiziell als „schwerbehindert“. Dann stehen Ihnen zusätzliche Nachteilsausgleiche zu, etwa steuerliche Vergünstigungen, Zusatzurlaub oder ein besonderer Kündigungsschutz.
Was ist kein Grad der Behinderung?
Der GdB ist kein ärztlicher Befund und auch keine Bewertung Ihrer Arbeitsfähigkeit. Er misst nicht, ob Sie noch arbeiten können, sondern wie stark Sie im Alltag beeinträchtigt sind. Ein Beispiel: Zwei Menschen haben beide Diabetes. Der eine ist gut eingestellt, spritzt selbstständig Insulin und lebt fast ohne Einschränkungen. Der andere ist auf Hilfe angewiesen, weil er Unterzuckerungen nicht selbst erkennt. Beide haben dieselbe Diagnose – aber ein ganz unterschiedliches Maß an Beeinträchtigung. Genau das bildet der GdB ab.
Wann brauchen Sie einen GdB?
Ein GdB wird wichtig, wenn Sie Nachteilsausgleiche in Anspruch nehmen möchten. Typische Beispiele:
- Steuererleichterungen (Behinderten-Pauschbetrag, außergewöhnliche Belastungen)
- Besonderer Kündigungsschutz am Arbeitsplatz
- Zusatzurlaub für schwerbehinderte Beschäftigte
- Parkerleichterungen oder unentgeltliche Beförderung im ÖPNV
- Vergünstigungen im Alltag, z. B. bei Eintrittspreisen
Für wen ist der GdB relevant?
Der GdB betrifft Menschen mit ganz unterschiedlichen Erkrankungen oder Behinderungen:
- Chronische Erkrankungen wie Rheuma, Morbus Crohn, Diabetes oder Migräne
- Psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder ADHS
- Körperliche Einschränkungen durch Unfälle, Operationen oder degenerative Krankheiten
- Angeborene Behinderungen wie Autismus oder geistige Entwicklungsstörungen
Beispiele aus der Praxis
Erfolgreiche Fälle
- Eine Mandantin mit chronischer Migräne, die ihre Beschwerden detailliert dokumentierte, erhielt einen GdB 40.
- Ein Jugendlicher mit Autismus, dessen Eltern die massiven Alltagseinschränkungen im Detail schilderten, bekam einen GdB 50.
- Ein Pflegehelfer mit kombinierter Wirbelsäulenfunktionsstörung und Schlafapnoe erreichte durch aktuelle Befunde einen GdB 60.
Weniger erfolgreiche Fälle
- Antrag ohne ärztliche Befunde („Das Amt soll sich die Unterlagen schon besorgen“) → Ergebnis: Ablehnung.
- Atteste ohne Bezug zum Alltag („Patient ist krank“) → Ergebnis: niedriger GdB.
- Nur Diagnosen, keine Beschreibung der Einschränkungen → Ergebnis: deutlich zu niedrige Einstufung.
Was brauchen Sie für den GdB-Antrag?
Diese Unterlagen sind unverzichtbar
- Antragsformular des Versorgungsamtes
- Aktuelle ärztliche Befunde (Fachärzte, Klinikberichte)
- Eigene Angaben zu den Alltagseinschränkungen – am besten in Form einer schriftlichen Stellungnahme
- Ergänzende Unterlagen wie Pflegegradbescheid, Rentengutachten oder Therapieberichte
Darauf können Sie verzichten
- Alte Arztberichte ohne Bezug zur aktuellen Situation
- Fachbegriffe ohne Erklärung
- Pauschale Aussagen wie „geht nicht mehr“ ohne Beispiele
Anleitung: So beantragen Sie den GdB
- Antragsformular besorgen
Online oder telefonisch beim zuständigen Versorgungsamt. - Eigene Angaben formulieren
Beschreiben Sie, wie Ihre Erkrankung den Alltag beeinträchtigt: Mobilität, Konzentration, Belastbarkeit, Schlaf usw. - Unterlagen beifügen
Reichen Sie aktuelle ärztliche Befunde ein. Bitten Sie Ihre Ärzte um Berichte, die konkrete Einschränkungen beschreiben. - Antrag einreichen
Vollständig ausgefüllt, mit allen Anlagen. - Bescheid abwarten
Dauer meist 3–6 Monate. - Widerspruch einlegen
Wenn der GdB zu niedrig festgesetzt wird oder der Antrag abgelehnt ist: Widerspruch einlegen.
👉 Mehr dazu: Widerspruch gegen den GdB-Bescheid
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Warum lohnt sich ein GdB-Antrag?
Weil er finanzielle Vorteile, rechtliche Absicherungen und konkrete Nachteilsausgleiche bringt.
Ist es nicht zu kompliziert?
Es wirkt kompliziert – aber mit guter Vorbereitung und klaren Angaben ist es machbar.
Was, wenn der Antrag abgelehnt wird?
Dann haben Sie ein Recht auf Widerspruch. Viele Verfahren werden erst im Widerspruch oder vor Gericht erfolgreich.
Muss ich alle Krankheiten angeben?
Ja – die Bewertung erfolgt im Gesamtbild. Jede relevante Erkrankung sollte aufgeführt werden.
Wie lange gilt der GdB?
Grundsätzlich gilt der festgestellte Grad der Behinderung unbefristet. Er bleibt bestehen, solange es keine wesentliche Änderung Ihrer gesundheitlichen Situation gibt.
Ausnahme: Bei bestimmten Krankheitsbildern, die sich erfahrungsgemäß bessern können – etwa nach einer Operation, während einer Heilbehandlung oder bei Therapien mit Aussicht auf Erfolg – befristet das Amt die Anerkennung häufig. In diesem Fall prüft es nach Ablauf der Frist, ob sich Ihr Zustand verbessert oder verschlechtert hat.
Ihre nächsten Schritte
- Laden Sie das Antragsformular Ihres Versorgungsamtes herunter.
- Sammeln Sie aktuelle Befunde und Berichte.
- Schreiben Sie eine eigene Übersicht über Ihre Einschränkungen – ehrlich, konkret, ohne Beschönigung.
👉 Und wenn Sie sich dabei Unterstützung wünschen: Mein Onlinekurs „Grad der Behinderung erfolgreich beantragen“ führt Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess. Mit Videos, Checklisten und Mustertexten, die Ihnen helfen, typische Fehler zu vermeiden und Ihre Chancen zu verbessern.